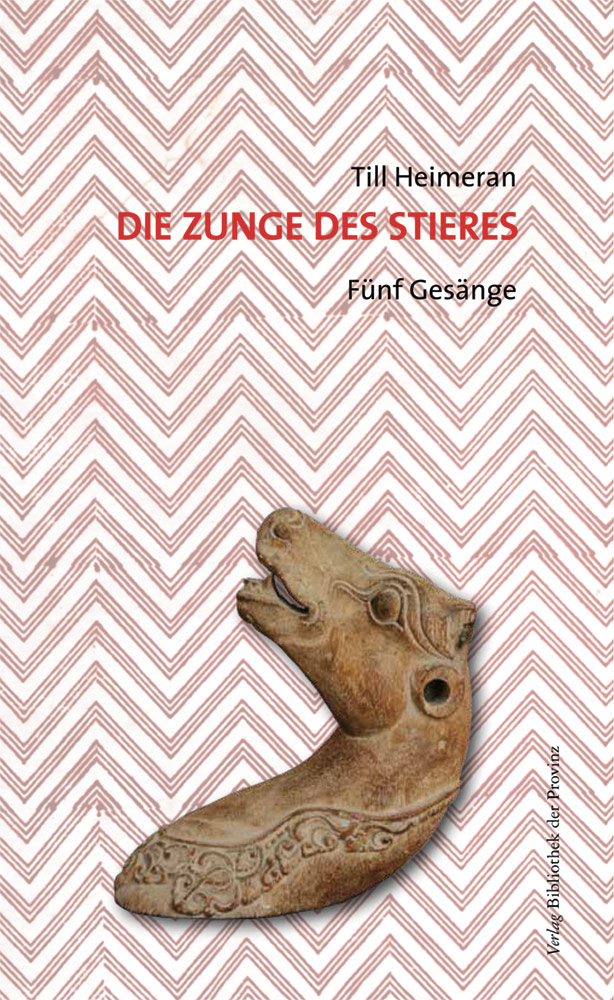
Die Zunge des Stieres
[Fünf Gesänge]
Till Heimeran
ISBN: 978-3-900000-19-6
21×12,5 cm, 72 Seiten, m. Abb., Klappenbroschur | Korr., neu gest., limit. & numm. 2. Aufl.: 99 Exemplare
12,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Auf der Einöde Löida zwängte sich im Mai ein vierwöchiges Stierkalb zwischen den Stangen des alten Schafzaunes aus der Weide, durchschwamm den Kaunitzer Graben, das tote Wasser zwischen den Abraumhalden des aufgelassenen Kohlebergwerkes, zog am Rand der Dickung auf dem Kamm, bis sich die Spur bei den Bienenhäusern in lichten Beständen verlor. Alle Versuche das Kalb einzufangen schlugen fehl und machten es überaus vorsichtig und scheu. Bald darauf sah ich es, im Wildacker am viereckigen Mais, mit dem Hochwild auf Äsung treten.
In fünf Kapiteln wird versucht, dem Lauf des Lichtes von Ost nach West über die Gipfel der Heiligen Berge zu folgen.
Auf dem Frühlingspunkt steigt der Stier aus dem Meer. Der Stier ist ein altes Kraftzeichen. In allen Kulturen verkörpert er den Beginn des Lebens aus dem Gestaltlosen.
Wie er zerstückelt und gefressen wird, wie seine Kraft in die Fressenden eingeht, wie er verschwindet und wieder erscheint.
Abstieg in die Tiefe. Verjüngter Aufflug.
Tod und Wiedergeburt.
Die Zunge, la lingua, ist eine Natursprache.
Sie wird überall gehört und nirgendwo verstanden.
Und so sind sie wieder vorbeigegangen.
Barfuß, in Sandalen, mit genagelten Stiefeln.
Rezensionen
Peter Kleinhans: Versuch einer AnnäherungTill Heimeran hat uns ein literarisches Vermächtnis hinterlassen, ein schmales zwar, aber doch ein gewichtiges. Nun liegt es an uns, dieses anzunehmen.
Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, als möchte er uns auf den Weg der griechischen Antike führen. Ist die Zunge des Stieres jene des Zeus, der sich in Gestalt ebenjenes Tieres liebevoll Europa angenähert hatte, jene Zunge, die die von ihr vertrauensvoll dargebotenen Wiesenblumen aufnahm, wonach Zeus die Verehrte sogleich wüst und wild nach Kreta entführte? Das wäre wohl nahe liegend in Anbetracht von Tills bekanntermaßen hellenophilem Geist. Doch die Lektüre belehrte mich eines besseren, genauer gesagt einer weit umfassenderen und vielschichtigeren Geisteshaltung. Das Buch ist ein Sprachkunstwerk aus Poesie und Prosa, eine imaginäre Reise durch die verschiedensten Kulturen und Epochen, ein Mosaik aus tausend Bausteinen, jeder einzelne davon kunstvoll und liebevoll geschaffen und alle zusammengefügt in einem universellen Geschichts- und Kunstverständnis.
„sapere aude! Habe Mut, dich deines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen.“ Diese Aussage des lateinischen Dichters Horaz, von Immanuel Kant Ende des 18. Jahrhunderts wieder aufgegriffen, wurde zum Leitgedanken der deutschen Aufklärung. Ich sehe darin eine zeitlose Gültigkeit und einen Schlüssel zum Verständnis von Tills Werk. Und so entdeckte ich aus jener Epoche einen bemerkenswerten Geistes- und Seelenverwandten von Till Heimeran: Johann Gottfried Herder, lange Jahre mit Goethe freundschaftlich verbunden und in Weimar lebend. Sein Spätwerk war die Zeitschrift Adrastea, die er 1801 herauszugeben begann und die das Resumee seines Schaffens sein sollte. Er starb am 18. Dezember 1803.
Sein Sohn Wilhelm Gottfried Herder bewerkstelligte posthum die Veröffentlichung im Verlag Hartnoth zu Leipzig im Jahr 1804. In dem von ihm verfaßten Vorwort heißt es: „Adrastea, diese hohe Göttin über Recht, Vernunft und Maß begleitete den verewigten Herausgeber bis in den Tod. Tief schmerzte es ihn, seine Adrastea unvollendet zu lassen, die gleichsam als die Siegelbewahrerin des Wissens und Geistes, des Urteils und Charakters des Verstorbenen von der Nachwelt anzusehen ist. Noch wenige Tage vor seinem Tode, schon in einem veränderten Gefühl seines Geistes und Körpers, wünschte er, nur noch zwei Stücke seiner Adrastea schreiben zu können. Sie sollten seine letzte vollendete Arbeit sein, in sie wollte er sein ganzes Bekenntnis legen, da ihm jetzt so manches anders erscheine. Dies waren seine Worte und seine Klagen. Wer fühlt aber diese Klagen mehr, als wem die Stimme der Adrastea zum Gemüt sprach?“ Dem Till hat „Die Zunge des Stieres“ zum Gemüt gesprochen und mit dieser wird er in uns weiterleben.
(Rezension: Peter Kleinhans, März 2010)
